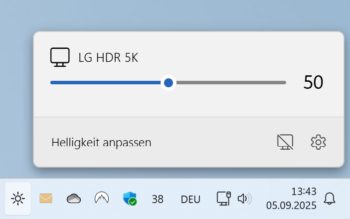Das Konzept volumetrischer 3D-Displays ist seit längerem bekannt, doch sind noch verschiedene Hürden zu nehmen bevor die Technik reif für praktische Anwendungen ist. Einer Forschungsgruppe aus amerikanischen und britischen Wissenschaftlern ist nun ein entscheidener Schritt auf dem Weg zu kommerziellen Anwendung volumetrischer Displays gelungen.
Die britischen Forscher Benjamin Mora und Min Chen von der Swansea University in Singleton Park, haben gemeinsam mit ihren amerikanischen Kollegen Ross Maciejewski und David S. Ebert von der Purdue School of Electrical and Computer Engineering in West Lafayette, Indiana eine Methode entwickelt mit der sich die Bildqualität volumetrischer 3D-Displays verbessern lässt.
Volumetrische Displays basieren auf tausenden von 3D-Pixeln –auch “Voxel” genannt– die das von einem sogenannten “isotropically emissive light device” (IEVD) ausgehende Licht entweder absorbieren oder emittieren. Dabei entsteht das dreidimensionale Bild indem Voxel auf einen mit 24 Umdrehungen pro Sekunde rotierenden Schirm projiziert werden. Da sich das Gesamtbild aus einer Vielzahl von Einzelzuständen, die entweder “Licht vorhanden” oder “kein Licht vorhanden” annehmen können, zusammensetzt, wird ein röntgenartiges räumliches Abbild der zugespielten Bilddaten erzeugt. Abgesehen vom großen naheliegenden Marktpotential im Unterhaltungssektor, tun sich viele Anwendungsfelder in Wissenschaft und industrieller Forschung auf, sowie anderen Bereichen in denen der Bedarf nach Möglichkeiten zur Visualisierung komplexer Strukturen, Pläne und Designs hoch ist. Sich abzeichnende Anwendungsmöglichkeiten in Bereichen wie Medizin, Architektur, Design, sind nur einige wenige Beispiele der vielversprechenden Technologie.
Ein Hindernis bei der Entwicklung marktreifer volumetrischer Displays besteht sowohl in der Schwierigkeit auf realistische Weise Schattierungen von Oberflächen nachzubilden als auch darin Objekte als vollständig lichtundurchlässig erscheinen zu lassen. Um in diesem Bereich Fortschritte zu erzielen, entwickelten die Forscher eine neuartige Methode, welche die ursprünglichen Bilddaten vor der Zuspielung derart modifiziert, dass ein höheres Maß an Schattierungen und abdunkelnden Effekten möglich wird.
Die Forscher waren in der Lage nachzuweisen, dass das nach Zuspielung der modifizierten Daten in den IEVD erzeugte 3D-Bild bezüglich der enthaltenen Schattierungseffekte konventionellen Computermonitoren ebenbürtig ist. Mit der neuen Lösung, einem zuvor für unüberwindbar gehaltenen Meilenstein, war es zudem möglich die Darstellungsqualität für lichtundurchlässige Objekte zu steigern.
Im Vergleich mit anderen 3D-Display-Technologien, die oft spezielle Brillen erfordern, verfügen Volumetrische Displays über diverse Vorteile. So lässt sich beispielsweise ganz ohne zusätzliche Sehhilfen die 3D-Darstellung aus verschiedenen Blickwinkeln wahrnehmen. Auch die gewaltige Menge an Daten, die sonst bei holografischen Techniken verarbeitet werden muss, fällt bei volumetrischen 3D-Displays wesentlich kleiner aus.
Dies, in Kombination mit der nun genommenen Hürde mittels Schattierungseffekten Oberflächenkrümmungen und Texturen darstellen zu können, verschafft der Technik zwar entscheidende Vorteile. Doch ist es den verhalten optimistischen Forschern noch ein wenig zu früh um den praktischen Einsatz volumetrischer Displays in greifbarer Nähe zu wähnen. Weitere Verbesserungen wie die Verringerung von Transparenzeffekten sowie die Erweiterung des Blickfeldes gilt es zunächst umzusetzen. Erste vielversprechende Ansätze für die Lösung einiger noch ungelöster Probleme vermutet man in der Projektion von 2 Bildern aus einander gegenüberliegen Seiten des rotierenden Bildschirms, womit sich mittels getrennter Bilddatenmodifizierung eine höhere Bildqualität erzielen ließe.
Zwar stünde einem Einsatz der Technik in Museen für die Zurschaustellung virtueller Objekte prinzipiell bereits nichts im Wege. Für den weitflächigen Einsatz besteht jedoch ein weiterer derzeit noch begrenzender Faktor in der hohen Prozessorgeschwindigkeit die von dieser Art Display zur Berechnung der 3D-Darstellung benötigt wird. Bei Marktreife ließen sich zukünftige Computersysteme leicht um ein volumetrisches Display als Zweitmonitor ergänzen.