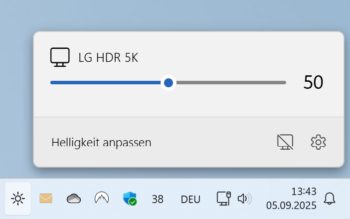Pro und Kontra
Trotz der potenziell geringeren absoluten Genauigkeit und der fehlenden Verfügbarkeit spektraler Informationen sind moderne Kolorimeter für die Vermessung von Monitoren oft die bessere Wahl. Dafür sprechen vor allem deutlich präzisere Messungen in den Schattenbereichen, die im Spektralverfahren erst von sehr teuren Geräten erreicht werden. Hinzu kommt der relativ grobe optische Bandpass von 10 nm. ISO 3664:2009 fordert hier mindestens 5 nm. Das wird besonders bei den schmalbandigen Emissionsspektren moderner Monitore mit hohem Farbumfang zu einem gewissen Unsicherheitsfaktor, wenn über steile Flanken hinweg verdichtet wird. Messgeräte mit entsprechender Präzision spielen jedoch in einer ganz anderen Preisliga.
Eine der günstigsten Alternativen dürfte hier das Jeti specbos 1211-L sein. Es handelt sich um ein reines Spektralradiometer (keine Reflexionsmessung möglich), dessen Preis den unseres Testgerätes um mehr als das Vierfache übersteigt. Nach oben hin sind dann für Geräte, die 1 nm Schrittweite bieten, faktisch keine Grenzen gesetzt. Aus diesem Grund müssen wir in diesem Bericht auch auf die Bewertung der Messgenauigkeit verzichten. Für Reflexionsmessungen reichen die 10 nm des i1Photo Pro 2 übrigens stets aus. Selbst die deutlich teureren Spektraldensitometer lösen nicht feiner auf.
Am Ende des Messtages stellen sich auch Fragen nach handfesten Vorteilen einer erhöhten absoluten Messgenauigkeit. Denn tatsächlich unterliegt die (Farb-)Messtechnik inhärenten Einschränkungen. Der normative Beobachter bildet allenfalls einen Durchschnitt, keinesfalls aber den individuellen Betrachter ab. Diese Beobachtermetamerie hat wiederum bei Monitoren teils erhebliche Auswirkungen. So wird im Zweischirmbetrieb mit zwei unterschiedlichen Monitoren eine Kalibration auf den gleichen messtechnischen Weißpunkt keine hinreichende visuelle Übereinstimmung erzielen. Hier gilt es, einen Bildschirm wie gewünscht zu kalibrieren und dann das Kalibrationsziel des zweiten Monitors so anzupassen, dass eine Übereinstimmung in den Neutraltönen erzielt wird. Bei einer Nachmessung des Weißpunktes sind dann Abweichungen bis über dE = 10 keine Seltenheit. Auch im Rahmen der Proof-Simulation ist eine pure, messtechnische Abstimmung und anschließende (absolute) Transformation meist nicht zielführend. „Messen wie man sieht“ beschreibt daher einen Weg, aber nicht das Ziel.
i1Pro vs. i1Pro 2
Abgesehen vom Gehäusedesign hat sich auch unter der Haube ein Generationenwechsel vollzogen. Dabei halten sich die Änderungen für die Lichtfarbmessung naturgemäß in Grenzen. Das ist kein Vorwurf an X-Rite. Angestrebte Preislage und Abmessungen führen zwangsläufig zu Kompromissen. Auffälligstes neues Merkmal ist hier der deutlich erhöhte garantierte Messbereich von bis zu 1200 cd/m². Damit können nun auch HDR-taugliche Monitore vermessen werden. X-Rite verspricht zudem eine verbesserte Temperaturstabilität.
Darüber hinaus wurden erweiterte Diagnosefunktionen (Statusmeldungen werden nun über LEDs am Gerät kommuniziert) und bedingte Korrekturmechanismen implementiert. Zusammen mit interessanten Detaillösungen wie der abnehmbaren Blende und dem Schutzdeckel des Weißstandards ist das deutliche Bemühen zu erkennen, dem Kunden mit der Weiterentwicklung einen echten Mehrwert zu bieten.
Wir haben eingangs von einem Generationenwechsel gesprochen. Und tatsächlich ist das i1Pro 2 eine erhebliche Weiterentwicklung, deren Vorteile sich allerdings vor allem im Rahmen von Reflexionsmessungen zeigen. Hier hat die Revision der ISO 13655 im Jahre 2009 (knapp zwei Jahre später wurde das i1Pro 2 erstmals vorgestellt) als Triebfeder gewirkt. Neu ist hier insbesondere die sogenannte Messbedingung M1. Die zum Einsatz kommende Lichtquelle soll D50 samt passendem UV-Anteil entsprechen. Damit werden optische Aufheller, Bestandteil vieler Auflagenpapiere, hinreichend und definiert angeregt. Sie absorbieren Licht im UV-Bereich und emittieren einen Großteil der Energie im blauen Bereich des sichtbaren Spektrums – damit wird der Weißegrad auf einfache Weise stark erhöht. Die Umsetzung ist aufwendig und nicht trivial. Bezieht sich der Einsatz von optischen Aufhellern nur auf den Bedruckstoff, kann ihr Einfluss auch berechnet werden. Zu diesem Zweck wird meist eine Messung gemäß M2 durchgeführt, und danach mittels einer UV-LED eine zweite Messung, die möglichst nur zu einer Anregung im UV-Bereich führt. Das i1Pro 2 nutzt diese Methode zur Umsetzung von Messbedingung M1.
Der letzte Satz deutet es an: Das i1Pro 2 unterstützt auch zwei der drei weiteren in ISO 13655 definierten Messbedingungen – so kann weiterhin nach M0 gemessen werden. Diese Bedingung stützt sich auf Glühlampen-ähnliches Licht (Lichtart A) mit vorhandenem, aber undefiniertem UV-Anteil (das ermittelte Reflexionsspektrum ist durch die Kalibration auf den Weißstandard unter allen Messbedingungen weiterhin Beleuchtungs-unabhängig). M2 schließt jeglichen UV-Anteil aus. Beim i1Pro musste man sich vor dem Kauf noch zwischen einer Variante ohne festen (für Messbedingung M0) und mit festem UV-Cut-Filter (für Messbedingung M2) entscheiden.
Beginnend mit der Revision des ISO 13655 wurden auch weitere Normen im Umfeld der grafischen Industrie angepasst. So sieht die ISO 12647-2 (Offset-Druck, ausgenommen Coldset-Zeitungsdruck) in ihrer Revision von 2013 die Messung nach M1 sowie neue Papierkategorien vor. Entsprechend wurde auch der Prozessstandard Offsetdruck 2016 nachgezogen. Die FOGRA stellt auf dieser Basis neue Charakterisierungsdaten bereit, die unter M1 ermittelt wurden. Schließlich bekräftigt auch die 2009 zeitgleich angepasste ISO 3664 (Betrachtungsbedingungen für die Abmusterung) das Ziel einer besseren Nachstellung von D50 im UV-Bereich. In Kombination ermöglicht dies die deutlich präziseren Ergebnisse und einen weiteren Schritt in Richtung des hehren Zieles: „Messen wie man sieht.“
Es handelt sich dementsprechend um kein Marketing-Feature, sondern um eine enorm wichtige Erweiterung. Optische Aufheller en masse finden sich übrigens gerade auch in gängigen Kopierpapieren für den heimischen (Farb-)Laserdrucker.